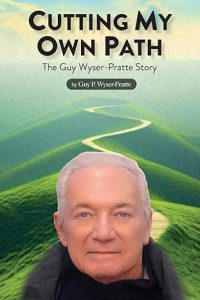 Angesichts der offenen Verachtung der gegenwärtigen amerikanischen Regierung für europäische Kultur und Zivilisation suchen die Transatlantiker händeringend nach Rettungsankern für den Dialog zwischen Europa und Amerika. Historisch gesehen bleibt Amerika trotz des Vulgo-Imperialismus von Donald Trump natürlich ein Off shot Europas. Es waren Europäer unterschiedlicher Nationen, die die neue Welt unter sich aufgeteilt haben und die westliche Zivilisation durch diese Eroberung zu einem Weltstandard machten. Dies kann auch der faktenrobuste gegenwärtige amerikanische Präsident schwerlich leugnen. (Weiterlesen …)
Angesichts der offenen Verachtung der gegenwärtigen amerikanischen Regierung für europäische Kultur und Zivilisation suchen die Transatlantiker händeringend nach Rettungsankern für den Dialog zwischen Europa und Amerika. Historisch gesehen bleibt Amerika trotz des Vulgo-Imperialismus von Donald Trump natürlich ein Off shot Europas. Es waren Europäer unterschiedlicher Nationen, die die neue Welt unter sich aufgeteilt haben und die westliche Zivilisation durch diese Eroberung zu einem Weltstandard machten. Dies kann auch der faktenrobuste gegenwärtige amerikanische Präsident schwerlich leugnen. (Weiterlesen …)
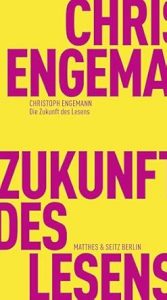 Dass die Leseaktivität und -bereitschaft der Menschheit trotz eines einmalig hohen Alphabetisierungsgrades seit Jahren zurückgeht, ist nichts Neues. Den Gründen hierfür nachzugehen und sie zu erforschen, macht sich der Medienwissenschaftler Christoph Engemann in seinem Essay über „ Die Zukunft des Lesens“ zur Aufgabe. Während „früher“ die Lektüre eines Buches ein zeitaufwendiges Insichgehen an einen ruhigen Platz oder den Gang in eine Bibliothek erforderte, wo das in einem Buch gesammelte Wissen materiell verankert war, reicht heute ein Klick, um nicht nur gewünschte Antworten auf einfache und komplizierte Fragen aus dem Internet zu erhalten, sondern auch von den Suchmaschinen der Hightech-Giganten Anregungen zu erhalten, auf welche Webseite man sich bewegen solle, um sein „Wissen“ zu vertiefen. (Weiterlesen …)
Dass die Leseaktivität und -bereitschaft der Menschheit trotz eines einmalig hohen Alphabetisierungsgrades seit Jahren zurückgeht, ist nichts Neues. Den Gründen hierfür nachzugehen und sie zu erforschen, macht sich der Medienwissenschaftler Christoph Engemann in seinem Essay über „ Die Zukunft des Lesens“ zur Aufgabe. Während „früher“ die Lektüre eines Buches ein zeitaufwendiges Insichgehen an einen ruhigen Platz oder den Gang in eine Bibliothek erforderte, wo das in einem Buch gesammelte Wissen materiell verankert war, reicht heute ein Klick, um nicht nur gewünschte Antworten auf einfache und komplizierte Fragen aus dem Internet zu erhalten, sondern auch von den Suchmaschinen der Hightech-Giganten Anregungen zu erhalten, auf welche Webseite man sich bewegen solle, um sein „Wissen“ zu vertiefen. (Weiterlesen …)
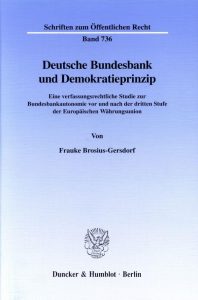 Gelegentlich der Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf für das Amt der Bundesverfassungsrichterin war die öffentliche Debatte über die Eignung der Kandidatin dadurch angeheizt und zum Teil entstellt worden, dass von einem „Plagiatsjäger“ die Behauptung aufgestellt wurde, die Dissertation von Brosius-Gersdorf beruhe auf den Gedanken ihres Ehemanns. Dieser hatte nach der Promotion seiner Gattin eine Studie zur verfassungsrechtlichen Legitimation der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand eingereicht. Die von dem „Plagiatsjäger“ erhobenen Vorwürfe sollen an dieser Stelle weder untersucht noch gewürdigt werden. Es ist schon für sich genommen erstaunlich, welche Wellen in der Öffentlichkeit die Behauptung selbsternannter Qualitätsskontrolleure mit einschlägigen politischen Überzeugungen schlagen können, ohne dass die Betroffenen sich hiergegen zu wehren vermögen. Da die Reputation das Kostbarste ist, worüber ein Wissenschaftler verfügt, sind anhaltende Schäden auch dann unvermeidbar, wenn im Nachhinein alle Vorwürfe entkräftet werden. (Weiterlesen …)
Gelegentlich der Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf für das Amt der Bundesverfassungsrichterin war die öffentliche Debatte über die Eignung der Kandidatin dadurch angeheizt und zum Teil entstellt worden, dass von einem „Plagiatsjäger“ die Behauptung aufgestellt wurde, die Dissertation von Brosius-Gersdorf beruhe auf den Gedanken ihres Ehemanns. Dieser hatte nach der Promotion seiner Gattin eine Studie zur verfassungsrechtlichen Legitimation der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand eingereicht. Die von dem „Plagiatsjäger“ erhobenen Vorwürfe sollen an dieser Stelle weder untersucht noch gewürdigt werden. Es ist schon für sich genommen erstaunlich, welche Wellen in der Öffentlichkeit die Behauptung selbsternannter Qualitätsskontrolleure mit einschlägigen politischen Überzeugungen schlagen können, ohne dass die Betroffenen sich hiergegen zu wehren vermögen. Da die Reputation das Kostbarste ist, worüber ein Wissenschaftler verfügt, sind anhaltende Schäden auch dann unvermeidbar, wenn im Nachhinein alle Vorwürfe entkräftet werden. (Weiterlesen …)
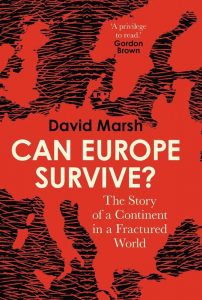 David Marsh‘s inspiring book on Europe’s past and future considers a serious, indeed profound question. Consequently it deserves diligent, insightful perusal and scrutiny rather than ritual endorsement by establishment figures.
David Marsh‘s inspiring book on Europe’s past and future considers a serious, indeed profound question. Consequently it deserves diligent, insightful perusal and scrutiny rather than ritual endorsement by establishment figures.
In the 1970s, the French political philosopher Julien Freund – alumnus of Raymond Aron and admirer of Carl Schmitt – made a striking prognosis in his book on decadence. According to his penetrating analysis, Europe was on the path of decline but that path would not be inevitable, if courageous statesmen confronted and reversed the trend.
David Marsh in his most recent book raises the same fundamental questions and guides the reader of his sophisticated prose through the post-1989 history of the continent. He is well positioned for such a historic review followed by some thought provoking proposals to enhance European ”resilience”. His network of interviewees comprises an impressive number of experts and statesmen who contribute their insights to the text. Some, perhaps superfluously, also add personal endorsements to David Marsh’s great publication. (Weiterlesen …)
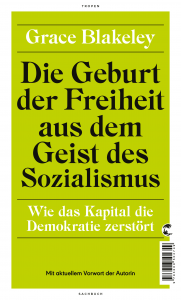 Der neugierige Leser schlägt ein Buch auf, das im Untertitel verspricht, zu erklären: „Wie das Kapital die Demokratie zerstört“ und findet gleichwohl keine Erfüllung dieses Versprechens nach der Lektüre von nahezu 500 Seiten. Die Autorin, eine ökonomisch gebildete Journalistin mit erheblichem Öffentlichkeitsecho, macht sich zunächst daran, die unterschiedlichen Kapitalismuskonzepte zu untersuchen und dabei zwischen den radikal-liberalen Konzepten von Hayek und dem Interventionskapitalismus seines Antipoden Keynes zu unterscheiden. Eine tiefgehende Auseinandersetzung mit diesen beiden Matadoren und ihren Thesen sucht man indessen vergebens. Stattdessen findet eine Abrechnung statt. Diese Abrechnung verharrt in der für radikal Linke häufig und anzutreffenden Gut und Böse-Diktion: Einerseits Großunternehmen und Kapital(täter) andererseits Arbeitnehmer (Opfer). Ob die Autorin sich den Anteil der Sozialabgaben im deutschen Bundeshaushalt 2026 einmal angeschaut hat, dürfte zu bezweifeln sein. (Weiterlesen …)
Der neugierige Leser schlägt ein Buch auf, das im Untertitel verspricht, zu erklären: „Wie das Kapital die Demokratie zerstört“ und findet gleichwohl keine Erfüllung dieses Versprechens nach der Lektüre von nahezu 500 Seiten. Die Autorin, eine ökonomisch gebildete Journalistin mit erheblichem Öffentlichkeitsecho, macht sich zunächst daran, die unterschiedlichen Kapitalismuskonzepte zu untersuchen und dabei zwischen den radikal-liberalen Konzepten von Hayek und dem Interventionskapitalismus seines Antipoden Keynes zu unterscheiden. Eine tiefgehende Auseinandersetzung mit diesen beiden Matadoren und ihren Thesen sucht man indessen vergebens. Stattdessen findet eine Abrechnung statt. Diese Abrechnung verharrt in der für radikal Linke häufig und anzutreffenden Gut und Böse-Diktion: Einerseits Großunternehmen und Kapital(täter) andererseits Arbeitnehmer (Opfer). Ob die Autorin sich den Anteil der Sozialabgaben im deutschen Bundeshaushalt 2026 einmal angeschaut hat, dürfte zu bezweifeln sein. (Weiterlesen …)
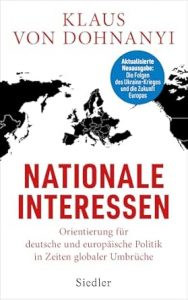 Auch in der Neuauflage seiner Streitschrift „Nationale Interessen“ ist sich Klaus von Dohnanyi treu geblieben: Er widerspricht dem strategielosen Establishment unseres Landes
Auch in der Neuauflage seiner Streitschrift „Nationale Interessen“ ist sich Klaus von Dohnanyi treu geblieben: Er widerspricht dem strategielosen Establishment unseres Landes
Dass ein Mitglied der DDR-Kultur-Establishment und notorischer Russland-Versteher wie Friedrich Dieckmann das Buch von Klaus von Dohnanyi dem Verfasser dieser Zeilen wiederholt zur Lektüre empfohlen hat, ist kein Grund, mit Vorurteilen an die Analyse des mit einem neuen, umfangreichen Vorwort versehenen Textes der Zweitauflage heranzugehen. Im Übrigen dürfte der Autor des Buches – Jahrgang 1928 und in vielen öffentlichen Ämtern erprobt – jenseits des Verdachtes stehen, im Ukrainekonflikt für irgendeine Seite Lobbyist zu sein. Der Text, insbesondere das neue Vorwort der Streitschrift, hat den Vorteil, mit einer eine Reihe von unkonventionellen Fragen die deutsche Strategiedebatte zu beleben . (Weiterlesen …)

Wenn ein renommierter Vertreter des deutschen Hochschulwesens – mit akademischen Erfahrungen in den USA und als Dekan einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sowie seit Jahren als Präsident einer mittelgroßen Universität – sich Gedanken über die Universitäten in Deutschland macht, so ist dies für sich genommen eine Anstrengung, die Respekt gebietet. Hans-Joachim Ewers, der ehemalige Präsident der TU Berlin, räsonnierte bereits bei seiner Berufung über das Missverhältnis von guter Lehre und wissenschaftlicher Reputation. Er wies u.a. darauf hin, dass die wissenschaftliche Reputation von der Anzahl und Qualität der Publikationen und nicht von der Güte der Lehre abhängen würden. Obschon mehr als ein Anstoß, blieben seine Ausführungen – besonders an der TU Berlin- unbeachtet. Ewers, Das Elend der Hochschulen – Eine ökonomische Analyse der Organisation und Finanzierung deutscher Universitäten, Text der Antrittsvorlesung vom 5.6.1995 ; Diskussionspapier 1996/13. (Weiterlesen …)
 Nachdem Ostpreußen als deutsche Kulturlandschaft wohl unwiederbringlich verloren ist und die Erinnerung hieran sofort den Soupcon des Rechtsradikalismus hervorruft, ist es wohltuend, wenn ein renommierter Journalist – ehemals Parlamentskorrespondet der Zeit – das Schatzkästlein seiner Familienerinnerung – hier die Erinnerungskladde seiner Großmutter – zum Anlass nimmt, um einen neuen Blick auf ein vergangenes Stück Deutschland zu werfen. Dabei fallen zunächst seine bedachten semantischen Richtigstellungen auf. Buchsteiner erinnert daran, dass der Begriff Ostdeutschland für die fünf neuen Bundesländer historisch und geographisch ungenau ist und die geographische Realität von Mitteldeutschland sich auch noch in Bezeichnungen wie Mitteldeutscher Rundfunk oder Mitteldeutscher Verlag manifestiert. Gut, dass ein solcher semantischer Anstoß von jemanden mit dem bildungsbürgerlichen Hintergrund des Buchautors kommt, statt derartige Richtigstellungen AfD-Politikern aus Thüringen zu überlassen. (Weiterlesen …)
Nachdem Ostpreußen als deutsche Kulturlandschaft wohl unwiederbringlich verloren ist und die Erinnerung hieran sofort den Soupcon des Rechtsradikalismus hervorruft, ist es wohltuend, wenn ein renommierter Journalist – ehemals Parlamentskorrespondet der Zeit – das Schatzkästlein seiner Familienerinnerung – hier die Erinnerungskladde seiner Großmutter – zum Anlass nimmt, um einen neuen Blick auf ein vergangenes Stück Deutschland zu werfen. Dabei fallen zunächst seine bedachten semantischen Richtigstellungen auf. Buchsteiner erinnert daran, dass der Begriff Ostdeutschland für die fünf neuen Bundesländer historisch und geographisch ungenau ist und die geographische Realität von Mitteldeutschland sich auch noch in Bezeichnungen wie Mitteldeutscher Rundfunk oder Mitteldeutscher Verlag manifestiert. Gut, dass ein solcher semantischer Anstoß von jemanden mit dem bildungsbürgerlichen Hintergrund des Buchautors kommt, statt derartige Richtigstellungen AfD-Politikern aus Thüringen zu überlassen. (Weiterlesen …)
 Spät, aber nicht zu spät, kommt die Vorstellung der Aufsatzsammlung von Matthias Buth unter der Überschrift „Die Verfassung der Dichter“. In einem bibliophil aufgemachten und doch sehr handlichen Band hat der bekannte Jurist und Lyriker Matthias Buth seine essayistischen Gedanken zur deutschen Kulturnation sowie zu Literatur, Musik und Kunst zusammengetragen.
Spät, aber nicht zu spät, kommt die Vorstellung der Aufsatzsammlung von Matthias Buth unter der Überschrift „Die Verfassung der Dichter“. In einem bibliophil aufgemachten und doch sehr handlichen Band hat der bekannte Jurist und Lyriker Matthias Buth seine essayistischen Gedanken zur deutschen Kulturnation sowie zu Literatur, Musik und Kunst zusammengetragen.
Dass die Besprechung des Werkes verzögert erscheint, macht nichts. Denn das Buch ist von bleibendem Wert, handelt es doch um ewig deutschen Themen, die Buth auf feuilletonistische Weise gemischt hat und mit Poesie abhandelt.
Dazu gehört für Buth die Auschwitz-Thematik, wenngleich Buth kritisch anmerkt, dass die Ausführungen von Bundeskanzlerin Merkel im israelischen Parlament über die „Sicherheit Israels als Teil deutscher Staatsräson“ juristisch und politisch höchst undurchdacht waren. So wie jedes leere Wort sich selbst entwerte, habe dieser Merkel-Ausspruch keine Wirkung gezeitigt. (Weiterlesen …)
 Das Bundesverfassungsgericht ist ins Gerede gekommen. Damit ist nicht die von bestimmten Vertretern des Partei Partei-Establishment beschworene Gefahr gemeint, dass im Falle des Wahlsiegs radikaler Parteien der Status des Gerichtes und seiner Besetzung ebenso radikal geändert würde. Vielmehr geht es um eine Reihe von prozessualen Anomalien, die sich beim Bundesverfassungsgericht über die Jahre „eingeschlichen“ haben, und die nur vom Radar der Fachöffentlichkeit wahrgenommen werden können. Zu diesen Anomalien gehört die wachsende Zahl „wissenschaftlicher Mitarbeiter“ des Gerichtes, deren Problematik als „Dritter Senat“ Gegenstand der staatsrechtlichen Diskussion sind genauso wie das ungeheuere Privileg des Gerichtes, aus Gründen der Überlastung von seinem Recht auf Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung durch begründungslosen, nicht rechtsmittelfähigen Beschluss Gebrauch zu machen (Vgl. § 93 a sowie 93 d Abs. 1 BVerfGG). Neben dieser Generalermächtigung des Gerichts, unliebsame Petenten auszusortieren sowie nur mit solchen Beschwerdeführern zu verhandeln, die man zuvor in einem Pilotverfahren ausgewählt hat, nimmt das Bundesverfassungsgericht auch für sich das Recht in Anspruch, Verfahren auszusitzen. (Weiterlesen …)
Das Bundesverfassungsgericht ist ins Gerede gekommen. Damit ist nicht die von bestimmten Vertretern des Partei Partei-Establishment beschworene Gefahr gemeint, dass im Falle des Wahlsiegs radikaler Parteien der Status des Gerichtes und seiner Besetzung ebenso radikal geändert würde. Vielmehr geht es um eine Reihe von prozessualen Anomalien, die sich beim Bundesverfassungsgericht über die Jahre „eingeschlichen“ haben, und die nur vom Radar der Fachöffentlichkeit wahrgenommen werden können. Zu diesen Anomalien gehört die wachsende Zahl „wissenschaftlicher Mitarbeiter“ des Gerichtes, deren Problematik als „Dritter Senat“ Gegenstand der staatsrechtlichen Diskussion sind genauso wie das ungeheuere Privileg des Gerichtes, aus Gründen der Überlastung von seinem Recht auf Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung durch begründungslosen, nicht rechtsmittelfähigen Beschluss Gebrauch zu machen (Vgl. § 93 a sowie 93 d Abs. 1 BVerfGG). Neben dieser Generalermächtigung des Gerichts, unliebsame Petenten auszusortieren sowie nur mit solchen Beschwerdeführern zu verhandeln, die man zuvor in einem Pilotverfahren ausgewählt hat, nimmt das Bundesverfassungsgericht auch für sich das Recht in Anspruch, Verfahren auszusitzen. (Weiterlesen …)
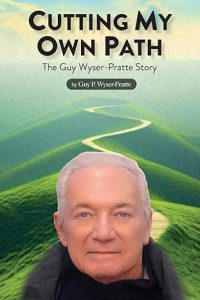 Angesichts der offenen Verachtung der gegenwärtigen amerikanischen Regierung für europäische Kultur und Zivilisation suchen die Transatlantiker händeringend nach Rettungsankern für den Dialog zwischen Europa und Amerika. Historisch gesehen bleibt Amerika trotz des Vulgo-Imperialismus von Donald Trump natürlich ein Off shot Europas. Es waren Europäer unterschiedlicher Nationen, die die neue Welt unter sich aufgeteilt haben und die westliche Zivilisation durch diese Eroberung zu einem Weltstandard machten. Dies kann auch der faktenrobuste gegenwärtige amerikanische Präsident schwerlich leugnen. (Weiterlesen …)
Angesichts der offenen Verachtung der gegenwärtigen amerikanischen Regierung für europäische Kultur und Zivilisation suchen die Transatlantiker händeringend nach Rettungsankern für den Dialog zwischen Europa und Amerika. Historisch gesehen bleibt Amerika trotz des Vulgo-Imperialismus von Donald Trump natürlich ein Off shot Europas. Es waren Europäer unterschiedlicher Nationen, die die neue Welt unter sich aufgeteilt haben und die westliche Zivilisation durch diese Eroberung zu einem Weltstandard machten. Dies kann auch der faktenrobuste gegenwärtige amerikanische Präsident schwerlich leugnen. (Weiterlesen …)
 deutsch
deutsch english
english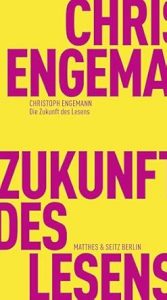 Dass die Leseaktivität und -bereitschaft der Menschheit trotz eines einmalig hohen Alphabetisierungsgrades seit Jahren zurückgeht, ist nichts Neues. Den Gründen hierfür nachzugehen und sie zu erforschen, macht sich der Medienwissenschaftler Christoph Engemann in seinem Essay über „ Die Zukunft des Lesens“ zur Aufgabe. Während „früher“ die Lektüre eines Buches ein zeitaufwendiges Insichgehen an einen ruhigen Platz oder den Gang in eine Bibliothek erforderte, wo das in einem Buch gesammelte Wissen materiell verankert war, reicht heute ein Klick, um nicht nur gewünschte Antworten auf einfache und komplizierte Fragen aus dem Internet zu erhalten, sondern auch von den Suchmaschinen der Hightech-Giganten Anregungen zu erhalten, auf welche Webseite man sich bewegen solle, um sein „Wissen“ zu vertiefen.
Dass die Leseaktivität und -bereitschaft der Menschheit trotz eines einmalig hohen Alphabetisierungsgrades seit Jahren zurückgeht, ist nichts Neues. Den Gründen hierfür nachzugehen und sie zu erforschen, macht sich der Medienwissenschaftler Christoph Engemann in seinem Essay über „ Die Zukunft des Lesens“ zur Aufgabe. Während „früher“ die Lektüre eines Buches ein zeitaufwendiges Insichgehen an einen ruhigen Platz oder den Gang in eine Bibliothek erforderte, wo das in einem Buch gesammelte Wissen materiell verankert war, reicht heute ein Klick, um nicht nur gewünschte Antworten auf einfache und komplizierte Fragen aus dem Internet zu erhalten, sondern auch von den Suchmaschinen der Hightech-Giganten Anregungen zu erhalten, auf welche Webseite man sich bewegen solle, um sein „Wissen“ zu vertiefen. 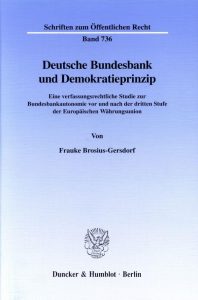 Gelegentlich der Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf für das Amt der Bundesverfassungsrichterin war die öffentliche Debatte über die Eignung der Kandidatin dadurch angeheizt und zum Teil entstellt worden, dass von einem „Plagiatsjäger“ die Behauptung aufgestellt wurde, die Dissertation von Brosius-Gersdorf beruhe auf den Gedanken ihres Ehemanns. Dieser hatte nach der Promotion seiner Gattin eine Studie zur verfassungsrechtlichen Legitimation der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand eingereicht. Die von dem „Plagiatsjäger“ erhobenen Vorwürfe sollen an dieser Stelle weder untersucht noch gewürdigt werden. Es ist schon für sich genommen erstaunlich, welche Wellen in der Öffentlichkeit die Behauptung selbsternannter Qualitätsskontrolleure mit einschlägigen politischen Überzeugungen schlagen können, ohne dass die Betroffenen sich hiergegen zu wehren vermögen. Da die Reputation das Kostbarste ist, worüber ein Wissenschaftler verfügt, sind anhaltende Schäden auch dann unvermeidbar, wenn im Nachhinein alle Vorwürfe entkräftet werden.
Gelegentlich der Nominierung von Frauke Brosius-Gersdorf für das Amt der Bundesverfassungsrichterin war die öffentliche Debatte über die Eignung der Kandidatin dadurch angeheizt und zum Teil entstellt worden, dass von einem „Plagiatsjäger“ die Behauptung aufgestellt wurde, die Dissertation von Brosius-Gersdorf beruhe auf den Gedanken ihres Ehemanns. Dieser hatte nach der Promotion seiner Gattin eine Studie zur verfassungsrechtlichen Legitimation der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand eingereicht. Die von dem „Plagiatsjäger“ erhobenen Vorwürfe sollen an dieser Stelle weder untersucht noch gewürdigt werden. Es ist schon für sich genommen erstaunlich, welche Wellen in der Öffentlichkeit die Behauptung selbsternannter Qualitätsskontrolleure mit einschlägigen politischen Überzeugungen schlagen können, ohne dass die Betroffenen sich hiergegen zu wehren vermögen. Da die Reputation das Kostbarste ist, worüber ein Wissenschaftler verfügt, sind anhaltende Schäden auch dann unvermeidbar, wenn im Nachhinein alle Vorwürfe entkräftet werden. 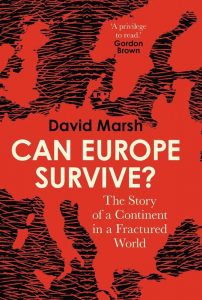 David Marsh‘s inspiring book on Europe’s past and future considers a serious, indeed profound question. Consequently it deserves diligent, insightful perusal and scrutiny rather than ritual endorsement by establishment figures.
David Marsh‘s inspiring book on Europe’s past and future considers a serious, indeed profound question. Consequently it deserves diligent, insightful perusal and scrutiny rather than ritual endorsement by establishment figures.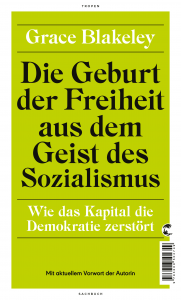 Der neugierige Leser schlägt ein Buch auf, das im Untertitel verspricht, zu erklären: „Wie das Kapital die Demokratie zerstört“ und findet gleichwohl keine Erfüllung dieses Versprechens nach der Lektüre von nahezu 500 Seiten. Die Autorin, eine ökonomisch gebildete Journalistin mit erheblichem Öffentlichkeitsecho, macht sich zunächst daran, die unterschiedlichen Kapitalismuskonzepte zu untersuchen und dabei zwischen den radikal-liberalen Konzepten von Hayek und dem Interventionskapitalismus seines Antipoden Keynes zu unterscheiden. Eine tiefgehende Auseinandersetzung mit diesen beiden Matadoren und ihren Thesen sucht man indessen vergebens. Stattdessen findet eine Abrechnung statt. Diese Abrechnung verharrt in der für radikal Linke häufig und anzutreffenden Gut und Böse-Diktion: Einerseits Großunternehmen und Kapital(täter) andererseits Arbeitnehmer (Opfer). Ob die Autorin sich den Anteil der Sozialabgaben im deutschen Bundeshaushalt 2026 einmal angeschaut hat, dürfte zu bezweifeln sein.
Der neugierige Leser schlägt ein Buch auf, das im Untertitel verspricht, zu erklären: „Wie das Kapital die Demokratie zerstört“ und findet gleichwohl keine Erfüllung dieses Versprechens nach der Lektüre von nahezu 500 Seiten. Die Autorin, eine ökonomisch gebildete Journalistin mit erheblichem Öffentlichkeitsecho, macht sich zunächst daran, die unterschiedlichen Kapitalismuskonzepte zu untersuchen und dabei zwischen den radikal-liberalen Konzepten von Hayek und dem Interventionskapitalismus seines Antipoden Keynes zu unterscheiden. Eine tiefgehende Auseinandersetzung mit diesen beiden Matadoren und ihren Thesen sucht man indessen vergebens. Stattdessen findet eine Abrechnung statt. Diese Abrechnung verharrt in der für radikal Linke häufig und anzutreffenden Gut und Böse-Diktion: Einerseits Großunternehmen und Kapital(täter) andererseits Arbeitnehmer (Opfer). Ob die Autorin sich den Anteil der Sozialabgaben im deutschen Bundeshaushalt 2026 einmal angeschaut hat, dürfte zu bezweifeln sein. 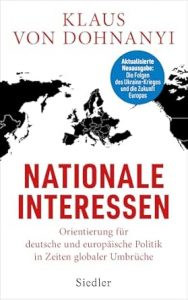 Auch in der Neuauflage seiner Streitschrift „Nationale Interessen“ ist sich Klaus von Dohnanyi treu geblieben: Er widerspricht dem strategielosen Establishment unseres Landes
Auch in der Neuauflage seiner Streitschrift „Nationale Interessen“ ist sich Klaus von Dohnanyi treu geblieben: Er widerspricht dem strategielosen Establishment unseres Landes
 Nachdem Ostpreußen als deutsche Kulturlandschaft wohl unwiederbringlich verloren ist und die Erinnerung hieran sofort den Soupcon des Rechtsradikalismus hervorruft, ist es wohltuend, wenn ein renommierter Journalist – ehemals Parlamentskorrespondet der Zeit – das Schatzkästlein seiner Familienerinnerung – hier die Erinnerungskladde seiner Großmutter – zum Anlass nimmt, um einen neuen Blick auf ein vergangenes Stück Deutschland zu werfen. Dabei fallen zunächst seine bedachten semantischen Richtigstellungen auf. Buchsteiner erinnert daran, dass der Begriff Ostdeutschland für die fünf neuen Bundesländer historisch und geographisch ungenau ist und die geographische Realität von Mitteldeutschland sich auch noch in Bezeichnungen wie Mitteldeutscher Rundfunk oder Mitteldeutscher Verlag manifestiert. Gut, dass ein solcher semantischer Anstoß von jemanden mit dem bildungsbürgerlichen Hintergrund des Buchautors kommt, statt derartige Richtigstellungen AfD-Politikern aus Thüringen zu überlassen.
Nachdem Ostpreußen als deutsche Kulturlandschaft wohl unwiederbringlich verloren ist und die Erinnerung hieran sofort den Soupcon des Rechtsradikalismus hervorruft, ist es wohltuend, wenn ein renommierter Journalist – ehemals Parlamentskorrespondet der Zeit – das Schatzkästlein seiner Familienerinnerung – hier die Erinnerungskladde seiner Großmutter – zum Anlass nimmt, um einen neuen Blick auf ein vergangenes Stück Deutschland zu werfen. Dabei fallen zunächst seine bedachten semantischen Richtigstellungen auf. Buchsteiner erinnert daran, dass der Begriff Ostdeutschland für die fünf neuen Bundesländer historisch und geographisch ungenau ist und die geographische Realität von Mitteldeutschland sich auch noch in Bezeichnungen wie Mitteldeutscher Rundfunk oder Mitteldeutscher Verlag manifestiert. Gut, dass ein solcher semantischer Anstoß von jemanden mit dem bildungsbürgerlichen Hintergrund des Buchautors kommt, statt derartige Richtigstellungen AfD-Politikern aus Thüringen zu überlassen.  Spät, aber nicht zu spät, kommt die Vorstellung der Aufsatzsammlung von Matthias Buth unter der Überschrift „Die Verfassung der Dichter“. In einem bibliophil aufgemachten und doch sehr handlichen Band hat der bekannte Jurist und Lyriker Matthias Buth seine essayistischen Gedanken zur deutschen Kulturnation sowie zu Literatur, Musik und Kunst zusammengetragen.
Spät, aber nicht zu spät, kommt die Vorstellung der Aufsatzsammlung von Matthias Buth unter der Überschrift „Die Verfassung der Dichter“. In einem bibliophil aufgemachten und doch sehr handlichen Band hat der bekannte Jurist und Lyriker Matthias Buth seine essayistischen Gedanken zur deutschen Kulturnation sowie zu Literatur, Musik und Kunst zusammengetragen. Das Bundesverfassungsgericht ist ins Gerede gekommen. Damit ist nicht die von bestimmten Vertretern des Partei Partei-Establishment beschworene Gefahr gemeint, dass im Falle des Wahlsiegs radikaler Parteien der Status des Gerichtes und seiner Besetzung ebenso radikal geändert würde. Vielmehr geht es um eine Reihe von prozessualen Anomalien, die sich beim Bundesverfassungsgericht über die Jahre „eingeschlichen“ haben, und die nur vom Radar der Fachöffentlichkeit wahrgenommen werden können. Zu diesen Anomalien gehört die wachsende Zahl „wissenschaftlicher Mitarbeiter“ des Gerichtes, deren Problematik als „Dritter Senat“ Gegenstand der staatsrechtlichen Diskussion sind genauso wie das ungeheuere Privileg des Gerichtes, aus Gründen der Überlastung von seinem Recht auf Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung durch begründungslosen, nicht rechtsmittelfähigen Beschluss Gebrauch zu machen (Vgl. § 93 a sowie 93 d Abs. 1 BVerfGG). Neben dieser Generalermächtigung des Gerichts, unliebsame Petenten auszusortieren sowie nur mit solchen Beschwerdeführern zu verhandeln, die man zuvor in einem Pilotverfahren ausgewählt hat, nimmt das Bundesverfassungsgericht auch für sich das Recht in Anspruch, Verfahren auszusitzen.
Das Bundesverfassungsgericht ist ins Gerede gekommen. Damit ist nicht die von bestimmten Vertretern des Partei Partei-Establishment beschworene Gefahr gemeint, dass im Falle des Wahlsiegs radikaler Parteien der Status des Gerichtes und seiner Besetzung ebenso radikal geändert würde. Vielmehr geht es um eine Reihe von prozessualen Anomalien, die sich beim Bundesverfassungsgericht über die Jahre „eingeschlichen“ haben, und die nur vom Radar der Fachöffentlichkeit wahrgenommen werden können. Zu diesen Anomalien gehört die wachsende Zahl „wissenschaftlicher Mitarbeiter“ des Gerichtes, deren Problematik als „Dritter Senat“ Gegenstand der staatsrechtlichen Diskussion sind genauso wie das ungeheuere Privileg des Gerichtes, aus Gründen der Überlastung von seinem Recht auf Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde zur Entscheidung durch begründungslosen, nicht rechtsmittelfähigen Beschluss Gebrauch zu machen (Vgl. § 93 a sowie 93 d Abs. 1 BVerfGG). Neben dieser Generalermächtigung des Gerichts, unliebsame Petenten auszusortieren sowie nur mit solchen Beschwerdeführern zu verhandeln, die man zuvor in einem Pilotverfahren ausgewählt hat, nimmt das Bundesverfassungsgericht auch für sich das Recht in Anspruch, Verfahren auszusitzen.